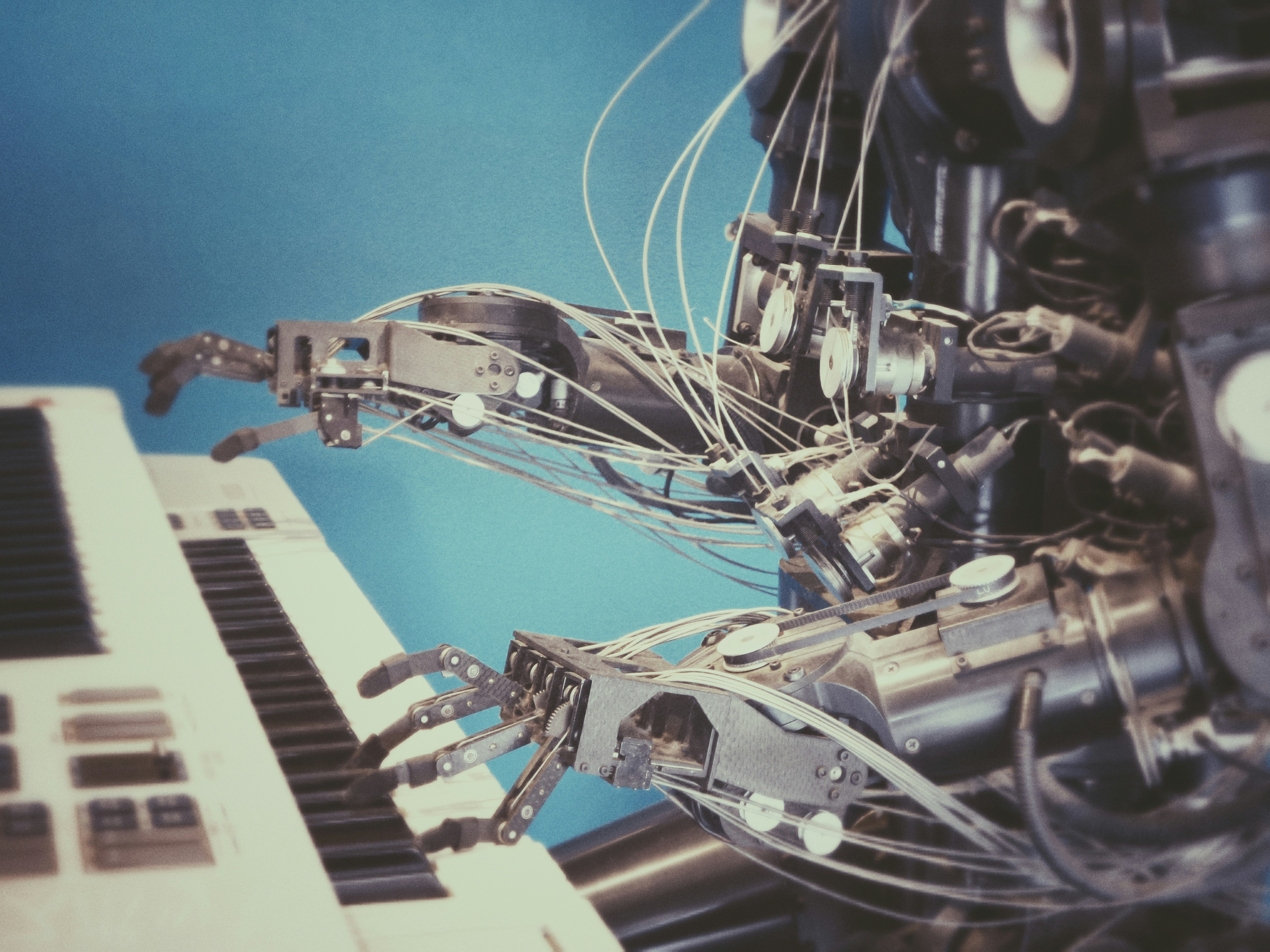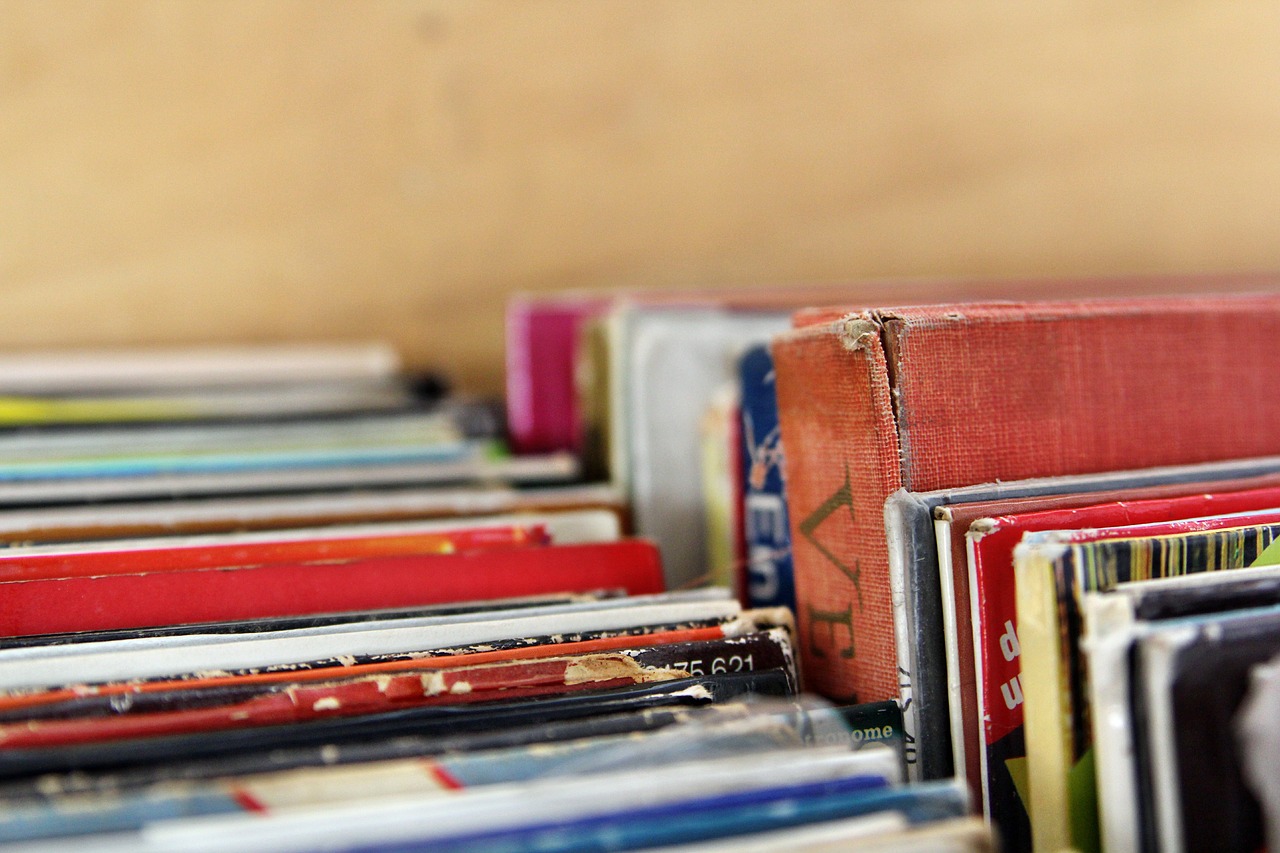Die irische Post-Punk-Band The Murder Capital hat zwei Konzerte in Deutschland abgesagt, nachdem Veranstaltungsorte ihnen verboten hatten, eine palästinensische Flagge auf der Bühne zu zeigen. Warum Veranstalter umdenken müssen.
Die betroffenen Shows in Berlin (Gretchen) und Köln (Gebäude 9) sollten am 10. und 11. Mai stattfinden. Die Band hatte offenbar geplant, bei ihren Auftritten erneut ein Zeichen für die palästinensische Bevölkerung zu setzen, wie sie es in der Vergangenheit mehrfach getan hatte.
Beide Clubs untersagten jedoch ausdrücklich das Mitführen der Flagge auf der Bühne, da in den Clubs grundsätzlich keine Nationalflaggen gezeigt werden sollten. Als die Band anbot, die palästinensische Flagge gegen ein “Free Palestine”-Banner auszutauschen, wurde auch das abgesagt.
Die Band reagierte prompt: Sie sagte die Clubshows ab und verlegte sie spontan unter freiem Himmel, als akustische Straßenkonzerte. Via Social Media rief sie Fans auf, eigene Gitarren mitzubringen. “Alle sind willkommen”, schrieb die Band.
Alle Anzeigen dauerhaft ausblenden
Auch das Konzert im Kölner Gebäude 9 wurde kurzfristig abgesagt. In München war ein Auftritt zwei Tage zuvor noch wie geplant über die Bühne gegangen – dort offenbar ohne derartige Auflagen.
„Kein politisches Statement“
Sänger James McGovern erklärte die Entscheidung in einem emotionalen Statement auf Instagram: „Diese Menschen werden ausgerottet, ausgehungert, bombardiert.“ Die Präsenz der palästinensischen Flagge auf ihrer Bühne sei „kein politisches Statement“, sondern „eine menschliche Reaktion auf eine schreckliche und unvorstellbare Situation“. The Murder Capital positionieren sich damit klar: Solidarität mit der palästinensischen Zivilbevölkerung ist für sie eine moralische Verpflichtung, kein Aktivismus im parteipolitischen Sinn. „[Die Flagge] muss auf unserer Bühne und so sichtbar wie möglich sein, überall auf der Welt.“
In Irland ist die Unterstützung der palästinensischen Zivilbevölkerung gegen die Attacken der israelischen Armee konsens. In Deutschland ist jedes Statement gegen Israel nach wie vor hochsensibel und kein Club möchte sich den Vorwurf des Antisemitismus anhören müssen. Aber es muss sich etwas ändern in Deutschland.
Kein Einzelfall – und keine Lösung
Der Vorfall reiht sich ein in eine zunehmende Zahl an Kontroversen, bei denen Künstler für ihre Haltung zum Nahostkonflikt sanktioniert werden. Das irische Hip-Hop-Kollektiv Kneecap wurde zuletzt nach einem pro-palästinensischen Statement beim Coachella-Festival von mehreren Line-ups gestrichen. In Großbritannien laufen polizeiliche Ermittlungen wegen angeblich extremistischer Aussagen. Gleichzeitig unterschrieben über 100 Musiker, darunter Pulp, Idles und Fontaines D.C., einen offenen Brief gegen diese Form der Repression.
Während der Diskurs um Meinungsfreiheit und politische Verantwortung in der Musikszene Fahrt aufnimmt, wächst in Deutschland die Unsicherheit. Absagen, Boykotte oder Verbote von Symbolen wie Flaggen lösen den Nahostkonflikt nicht – sie verschärfen ihn auch nicht, aber sie ersticken den kulturellen Austausch. Wenn Räume der Popkultur, die traditionell als Freiräume für gesellschaftliche Debatten galten, durch politische Vorgaben beschränkt werden, geht es längst nicht mehr nur um Flaggen.
PEN Berlin: Kultureller Austausch statt moralischer Ausschluss
Der PEN Berlin spricht sich entschieden und grundsätzlich gegen alle Formen des Kulturboykotts aus. Diese Position wurde von der ehemaligen PEN-Berlin-Sprecherin Eva Menasse ausführlich und eindrücklich dargelegt – anlässlich eines internationalen Boykottaufrufs, in dem über tausend Kulturschaffende dazu aufgerufen hatten, keine Zusammenarbeit mehr mit israelischen Künstler*innen oder Institutionen einzugehen, die „sich an der Verletzung der Rechte der Palästinenser mitschuldig machen“.
Für den PEN Berlin steht fest: Kulturboykott ist immer falsch – unabhängig von Richtung, Anlass oder politischem Kontext. Diese Haltung beruft sich direkt auf die Gründungsprinzipien des weltweiten PEN-Netzwerks, das 1920 als Reaktion auf die propagandistische Instrumentalisierung von Literatur im Ersten Weltkrieg entstand. Ziel war es von Anfang an, auch in Zeiten von Krieg und Unrecht den Dialog zwischen Schriftsteller*innen aufrechtzuerhalten.
Menasse bringt es so auf den Punkt: „Wenn man ganz grundsätzlich gegen Kulturboykott ist, dann darf man auch Menschen nicht boykottieren, die schon einmal für Kulturboykott unterschrieben haben.“ Das bedeutet: Eine Ablehnung politischer Sanktionen im Kulturbereich gilt sowohl für pro-israelische als auch für pro-palästinensische Stimmen, für Kritikerinnen der israelischen Regierung ebenso wie für Unterstützerinnen des BDS (Boycott, Divestment and Sanctions).
Alle Anzeigen dauerhaft ausblenden
Wenn wir Musiker ausschließen, die eine klare politische Meinung haben oder auf ein politisches Problem aufmerksam machen wollen, sollten wir diese Meinungsäußerung nicht verbieten, so lange sie nicht gegen geltende Gesetze verstößt oder zum Hass gegen Minderheiten aufruft. Das ist bei der Unterstützung eines freien Palästina nicht zu erkennen.
Der deutsche Sonderweg
Gerade in Deutschland wird die Debatte besonders hitzig geführt – nicht selten mit einseitiger Stoßrichtung. Die Solidarität mit Israel ist historisch gewachsen und staatlich verankert. Doch dieser Konsens darf nicht dazu führen, dass kritische Stimmen, die sich mit dem Schicksal der palästinensischen Bevölkerung befassen, pauschal diffamiert oder zensiert werden. Die humanitäre Lage in Gaza ist mittlerweile katastrophal, über 50.000 Tote, Hunderttausende auf der Flucht, alle Infrastruktur zerbombt.
Gleichzeitig mehren sich Hinweise darauf, dass die israelische Regierung offenbar plant, große Teile des Gazastreifens dauerhaft zu besetzen und ethnisch zu säubern. Trump träumt sogar davon, Luxushotels auf dem Gazastreifen zu bauen. Das ist eine dramatische Entwicklung, der man sich auch in Deutschland stellen muss, ohne vorschnell in Denkmuster von historischer Schuld zu verfallen.
Man kann das Extistenzrecht Israels anerkennen ohne die Taten der israelischen Regierung einfach hinzunehmen, deren Premier per internationalem Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen gesucht wird. Das ist eine neue Dimension, die ein Umdenken in Deutschland erfordert.
Alle Anzeigen dauerhaft ausblenden
Keine Flaggen, keine Farben – aber Haltung muss erlaubt sein
Viele Veranstalter verbieten inzwischen das Zeigen jeglicher Flaggen bei Konzerten, um Konflikte zu vermeiden. Dieser Wunsch nach Neutralität ist in aufgeheizten politischen Zeiten nachvollziehbar. Doch daraus ein generelles Verbot politischer Meinungsäußerung abzuleiten, sendet die falsche Botschaft. Musiker*innen dürfen und müssen Haltung zeigen dürfen, solange sie keine Gesetze brechen. Gerade alternative Popkultur lebt von Dissens, Reibung und Ambivalenz. Wenn diese Räume nicht mehr für gesellschaftliche Diskussionen offenstehen, verkommt Kultur zur reinen Unterhaltung.
Dass The Murder Capital trotz Absagen eine Alternative auf der Straße suchten, zeigt, dass es um mehr geht als nur eine Flagge. Es geht um das Recht, als Künstler menschlich zu reagieren – auf eine Realität, die täglich in den Nachrichten sichtbar ist. Wer solche Gesten als “zu politisch” verbietet, riskiert, Kultur auf ihr dekoratives Minimum zu reduzieren.
Musikfans von solchen Bands sind erwachsene Menschen und halten auch eine Debatte über die Rolle Israels im Gaza-Konflikt aus, ganz egal wo man auch politisch stehen mag. Wir müssen unsere Kultur fördern und dürfen diesen offenen Austausch miteinander nicht unterdrücken. Cancel Culture ist nicht die Lösung, sondern verschärft das Problem weiter.