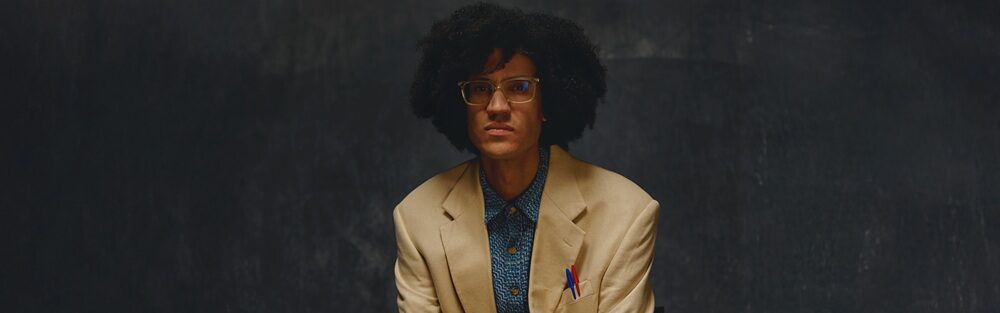Das Southside Festival geht vom 19. bis 21. Juni 2026 in die nächste Runde und bringt erneut ein hochkarätiges Line-up nach Neuhausen ob Eck. Wir verlosen Tickets!
Mit Billy Talent, Kraftklub und Twenty One Pilots stehen drei Bands an der Spitze des Programms, die seit Jahren zu den verlässlichen Festivalgrößen zählen. Ergänzt wird das Headliner-Feld von Florence + The Machine, The Offspring, Halsey, Empire Of The Sun und Papa Roach. Damit setzt das Schwesterfestival des Hurricane auch im Süden auf eine Mischung aus internationalem Pop, Alternative, Punk und großen Live-Produktionen.
Verlosung bei Tonspion
Im März verlosen wir unter allen Abonnenten des Tonspion Updates 1×2 Festivaltickets inklusive Camping für das Southside Festival oder das Hurricane Festival 2026. Wer teilnehmen möchte, sollte das kostenlose Tonspion Update abonnieren.
Teilnahmeschluss ist der 31.3.2026. Die Gewinner werden informiert.
Billy Talent stehen für druckvollen Alternative Rock mit hoher Live-Intensität, Kraftklub verbinden Indie-Rock mit klarer Haltung und Publikumsnähe. Twenty One Pilots schlagen die Brücke zwischen Alternative, Rap und Pop und erreichen damit ein generationenübergreifendes Publikum. Florence + The Machine bringen hymnischen Art-Pop auf die Bühne, während Acts wie The Offspring oder Papa Roach die Rocktradition des Festivals fortschreiben, während Halsey und Empire Of The Sun visuelle und elektronische Akzente setzen.
Neben den Headlinern spiegelt das Programm die stilistische Offenheit des Festivals wider. Mit Provinz, Clueso, BHZ oder OG Keemo sind aktuelle deutschsprachige Acts vertreten, während Nothing But Thieves, Wolf Alice oder Alexisonfire internationale Alternative-Positionen einbringen. Die Electric Wave x White Stage setzt mit Modeselektor, Boys Noize, Tinlicker oder David Puentez einen klaren elektronischen Schwerpunkt.
Alle Anzeigen dauerhaft ausblenden
Hier das vollständige Line-up nach Tagen:
19. Juni 2026
Billy Talent
Halsey
Provinz
Empire Of The Sun
A Day To Remember
Clueso
BHZ
The Butcher Sisters
Levin Liam
Leony
Filow
Skindred
Sprints
PA69
Tors
Vicky
Davina Michelle
Delilah Bon
Unpeople
Just Mustard
Electric Wave x White Stage:
Modeselektor
Boys Noize
20. Juni 2026
Kraftklub
Yungblud
The Offspring
Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys
Donots
Bosse
Sondaschule
Royel Otis
Drunken Masters
Pennywise
The Beaches
Grandson
Zebrahead
President
Betterov
Basement
Esther Graf
Kayla Shyx
The Ataris
Rosmarin
Ecca Vandal
Anda Morts
Militarie Gun
Paula Engels
Leila Lamb
Electric Wave x White Stage:
Modestep (Live)
Roya
21. Juni 2026
Twenty One Pilots
Florence + The Machine
Papa Roach
Finch
Nothing But Thieves
Wolf Alice
SSIO
Alexisonfire
All Time Low
Kaffkiez
Natasha Bedingfield
Edwin Rosen
OG Keemo
Orville Peck
Kasi
Ritter Lean
Destroy Boys
RØRY
Kingfishr
Florence Road
Drei Meter Feldweg
Yonaka
Picture Parlour
Electric Wave x White Stage:
David Puentez
Tinlicker
Tickets und Camping
Der Festivalpass All Days für alle drei Tage kostet 269 Euro. Zusätzlich wird der Festivalpass Grüner Wohnen All Days ebenfalls für 269 Euro angeboten. Details zu den jeweiligen Leistungen stellt der Veranstalter bereit.
Alle Anzeigen dauerhaft ausblenden
Für Besucher, die mehr Komfort wünschen, gibt es das Resort Camping für 249 Euro.
Im Power Claim Resort kann ergänzend eine Stromparzelle mit 230 Volt und maximal 1000 Watt für den gesamten Festivalzeitraum gebucht werden. Die Stromparzelle ist ein Zusatzangebot innerhalb des Resort Camping. Ein Resort-Camping-Ticket pro Person ist zusätzlich erforderlich.